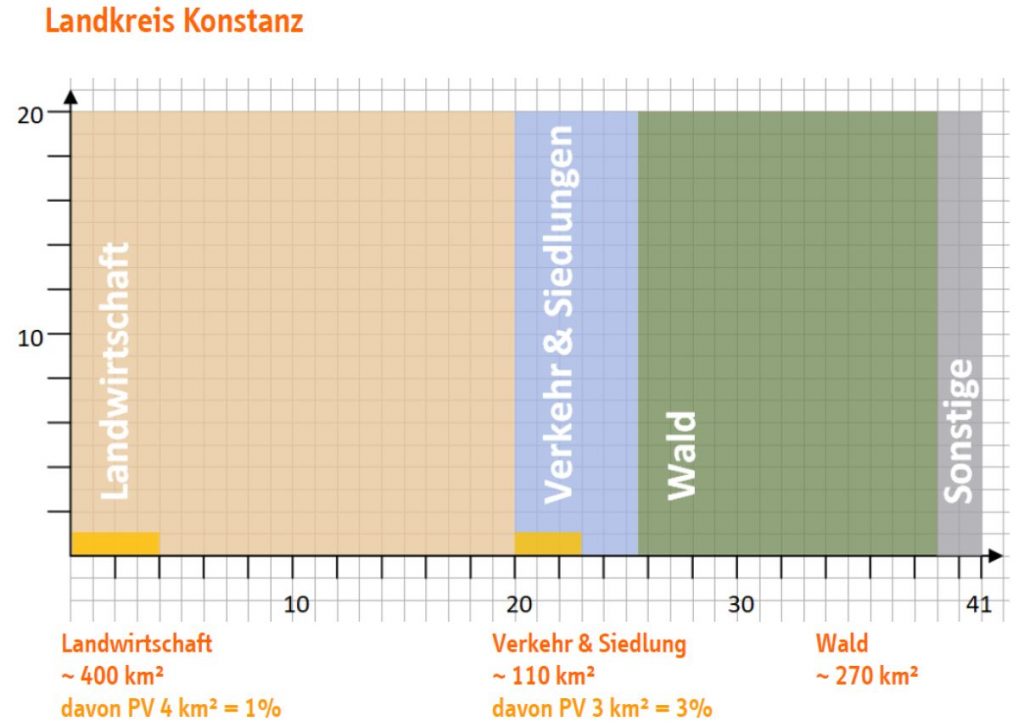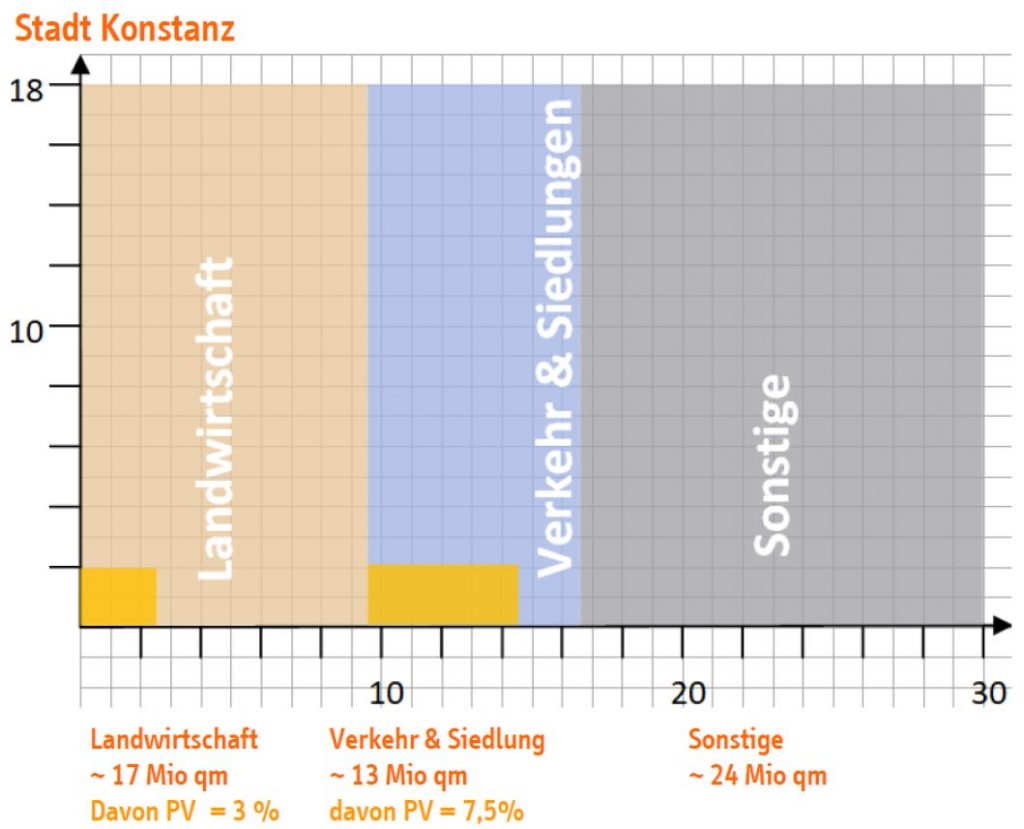Stuttgart, 11. Mai 2020
Plattform EE BW veröffentlicht Ausbauplan für erneuerbare Energien
Baden-Württemberg muss seine Treibhausgasemissionen deutlich stärker reduzieren als bislang vorgesehen. Nur so kann das Land seinen Beitrag zu den Pariser Klimaschutzbeschlüssen leisten. Das zeigt eine am 11. Mai 2020 veröffentlichte Studie im Auftrag der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. Um die Ziele zu erreichen, ist vor allem ein beschleunigter Ausbau von Wind- und Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien erforderlich. Die Untersuchung empfiehlt im Ausbauszenario “BW PLUS“ einen Zubau von 13 Gigawatt installierter Ökostromleistung auf insgesamt 22 Gigawatt bis 2030. Damit könnte der Anteil erneuerbaren Stroms auf 70 Prozent steigen. Im Wärmesektor soll der Anteil Erneuerbarer von 17 auf 27 Prozent zulegen. Möglich ist ein solcher Umbau der Energieversorgung für Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen durchaus, so die Plattform EE BW. Sie erwartet dadurch auch positive Konjunktureffekte in der Corona-Krise. Erforderlich dafür sind jedoch angepasste Rahmenbedingungen auf allen politischen Ebenen. So brauche es etwa eine Photovoltaikpflicht zumindest im Neubau sowie beschleunigte Genehmigungsverfahren.
Die von Dr. Joachim Nitsch erstellte Studie „Ausbau der erneuerbaren Energien für eine wirksame Klimapolitik in Baden-Württemberg“ zeigt an Hand von vier Szenarien, zu welchem Ergebnis verschiedene Ausbaupfade erneuerbarer Energien kommen und ob sie zu der notwendigen Reduktion von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 beziehungsweise 2050 führen. Der Fokus liegt dabei auf der Strom- und Wärmeerzeugung, mit einem kurzen Exkurs zum Mobilitätsbereich. Die vier Szenarien bauen aufeinander auf: Das erste entspricht dem Ziel der Landesregierung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 42 Prozent zu senken (Szenario ZIEL BW). Das zweite ergänzt es um den auf Bundesebene beschlossenen Kohleausstieg (Szenario KOHLE 38). Das dritte setzt auf verstärkten EE-Ausbau und geht von einem auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg aus (Szenario BW PLUS) und das vierte baut erhöhte Effizienzmaßnahmen und Verbrauchssenkungen in allen Sektoren ein (Szenario ZIEL PARIS).
Fortgeschriebenes Klimaschutzgesetz reicht nicht aus
In die Studie flossen auch Einschätzungen der Plattform Erneuerbare Energien BW und ihrer Mitgliedsverbände ein. Der wissenschaftlichen Grundlage wurde so eine unternehmerische Perspektive hinzugefügt, unter anderem was die Machbarkeit angeht. „Das in der Studie beschriebene Ausbauszenario BW PLUS zeigt den notwendigen Handlungsbedarf für den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren als Mindestmaß für echten Klimaschutz”, sagt Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform EE BW. Es entspricht einer Halbierung der Treibhausgasemissionen Baden-Württembergs von 1990 bis 2030 und hält damit die Tür offen für die Erreichung des Pariser Klimaziels. In Baden-Württemberg sind bislang nur 42 Prozent Reduktion vorgesehen.
Die Landesregierung hat mit der Fortschreibung des Klimaschutzgesetzes den richtigen Weg eingeschlagen. Jedoch ist das Ziel zu bescheiden und damit kein ausreichender Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen. „Baden-Württemberg muss den Ausstoß von Treibhausgasen schneller reduzieren als bislang, eine Versechsfachung der jährlichen Reduktionsrate ist das Mindestmaß für wirksamen Klimaschutz. Ein ambitionierter Ausbau erneuerbarer Energien ist dafür unabdingbar”, so Dürr-Pucher. Die Unternehmen der Erneuerbaren-Branchen können und wollen einen solchen verstärkten Ausbau umsetzen.
Wie dieser konkret aussehen kann, wird in der veröffentlichten Studie skizziert. Eine solche Stimulierung des Erneuerbaren-Ausbaus bedeutet mehr lokale Wertschöpfung und die Schaffung neuer Arbeitsplätze und kann dabei helfen, die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise abzumildern. Verstärkte Investitionen in eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur müssen Teil eines nachhaltigen Konjunkturpaketes sein.
Höhere Zubauraten notwendig
„Das Szenario BW PLUS zeigt, dass durchschnittliche Zubauraten für Photovoltaik von 870 Megawatt installierte Leistung pro Jahr beziehungsweise für Windenergie von 325 Megawatt pro Jahr bis 2030 notwendig sind, um beim Klimaschutz voranzukommen. Damit liegen sie höher als in den letzten zwei Jahren, zugleich aber weit hinter den jeweiligen Spitzenwerten zurückliegender Jahre”, so Pöter. Statt des bislang stark schwankenden Zubaus muss es jetzt eine Verstetigung und Stabilisierung des Marktes geben. Auch bei den anteilig kleineren Erneuerbaren gilt es noch Potenziale zu heben, zum Beispiel bei der Wasserkraft durch Modernisierung alter Anlagen und Nutzung bereits bestehender Querverbauungen wie Wehre für die Wasserkraft. Insgesamt können so im Jahr 2030 22 Gigawatt erneuerbare Energien im Stromsektor installiert sein. Der Naturschutz und die Beteiligung der (lokalen) Bevölkerung müssen und können dabei angemessen berücksichtigt werden.
Für einen erfolgreichen Klimaschutz ist auch die Umgestaltung des Wärmesektors essenziell: 2018 stammte knapp die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen Baden-Württembergs aus diesem Bereich. Als Grundlage sieht die Studie den Ausbau von Wärmenetzen, deren Anteil an der Wärmebereitstellung sich im Ausbauszenario BW PLUS von jetzt 15 auf 30 Prozent im Jahr 2030 verdoppelt. Der Neubau von bis zu zehn neuen Geothermieanlagen ist darin ebenso vorgesehen wie eine leichte Steigerung der Wärmeerzeugung durch Biomasse. Dafür kommen bislang ungenutzte Holzpotenziale sowie eine stärkere Gülle- und Mistvergärung in Frage. Im Bereich der Solarthermie verdoppelt sich die Kollektorfläche auf neun Millionen Quadratmeter, darunter vermehrt große Freiflächenanlagen, die in Wärmenetze einspeisen. Wo es keine netzgebundenen Alternativen gibt, kommen Wärmepumpen zum Einsatz, mit einem verstetigten Zubau von wie heute 25.000 Stück pro Jahr. Zusammen mit einer sinkenden Gesamtnachfrage nach Wärme (minus 20 Prozent bis 2030) durch Effizienzmaßnahmen könnte der Südwesten den Anteil erneuerbarer Energien auf 27 Prozent des Wärmeverbrauchs steigern.
Rahmenbedingungen anpassen
Um die Ausbaupfade zu erreichen, fordert die Plattform EE BW auf landes- wie bundespolitischer Ebene eine Reihe von Änderungen. „Wir müssen Genehmigungsverfahren beschleunigen und vereinheitlichen, um Realisierungszeiträume für EE-Projekte wieder zu verkürzen. Außerdem müssen bestehende Ausbaugrenzen und Degressionsmechanismen im Rahmen der anstehenden EEG-Novelle beseitigt werden“, fordert Pöter. „Auch eine Solardachpflicht lohnt sich für das Klima – und die Hauseigentümer.“ Darüber hinaus bedarf die Ausschöpfung noch vorhandener Potenziale insbesondere in der Biomasse und Wasserkraft einer expliziten Unterstützung durch die Politik.
Das bereits angekündigte Instrument der Wärmeleitplanung sollte für alle Kommunen verpflichtend sein, um so auch den Bau von Wärmenetzen voranzubringen und damit größere Projekte zum Beispiel der Geothermie oder der Solarthermie zu ermöglichen. Eine echte Sektorkopplung zwischen Strom, Wärme und Mobilität, die zum Beispiel durch den Aufbau von Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff auf den Weg gebracht werden kann, und ein angemessener CO2-Preis bilden den weiteren Rahmen für einen ambitionierten Ausbau erneuerbarer Energien in Baden-Württemberg.
Dr. Jörg Dürr-Pucher, Vorsitzender der Plattform EE BW, über die Studie und die Forderungen der Plattform EE:
Youtube
ÜBER DIE PLATTFORM EE BW
Die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e.V. ist eine Dachorganisation der Verbände, Unternehmen und Forschungsinstitute aus der Erneuerbaren-Energien-Branche in Baden-Württemberg. Der Verein wurde im März 2019 gegründet und setzt sich für den schnellen Ausbau der Erneuerbaren Energien und die sektorenübergreifende Umsetzung der Energiewende in Baden-Württemberg ein. Die Vereinszwecke der Plattform EE sind, die klimapolitische, industriepolitische und volkswirtschaftliche Bedeutung der Erneuerbaren noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, den Vorteil für Verbraucher, Unternehmen und Kommunen darzustellen sowie die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien aktiv mitzugestalten.
Medienkontakt:
Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg e.V.
Franz Pöter; Geschäftsführer
Tel.: +49 711 7870-309
Mobil: 0172-3439802
franz.poeter@erneuerbare-bw.de
www.erneuerbare-bw.de
PR-Agentur Solar Consulting
Axel Vartmann
Tel. +49 761 380968-23
vartmann@solar-consulting.de
www.solar-consulting.de